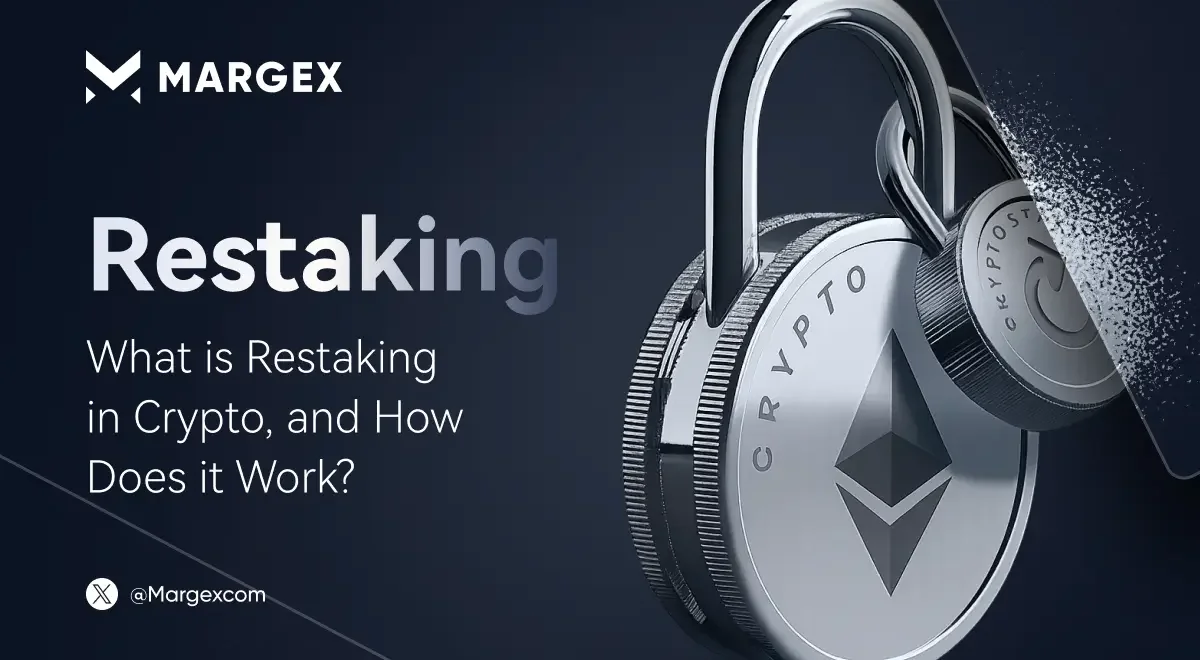
Das Staking von Kryptowährungen ist eine der gängigsten Methoden, mit denen Anleger passive Erträge erzielen. Aber es gibt einen Haken: Sobald Token gestaked sind, sind sie in einem einzigen Netzwerk gesperrt. Sie sichern diese Kette, können aber nirgendwo anders verwendet werden.
Eine neue Idee namens Restaking ändert dies. Damit können dieselben gestakten Vermögenswerte mehr als ein Protokoll gleichzeitig sichern. Einfach ausgedrückt ist es so, als würde man seine Kryptowährung zweimal einsetzen, ohne sie zu unstaken. Die Sicherheit, die eine Blockchain schützt, kann nun auch zum Schutz anderer beitragen.
Dieses Konzept entstand bei Ethereum und verbreitet sich schnell im gesamten Kryptoraum, einschließlich Blockchains wie Ethereum und Solana. In diesem Artikel besprechen wir, was Restaking in Kryptowährungen ist, wie es funktioniert, welche Vorteile es hat und welche Risiken damit verbunden sind.
Wichtige Erkenntnisse
- Restaking = zweimaliges (oder mehrmaliges) Staking: Sie verwenden bereits gestakte Token erneut, um mehrere Blockchains oder Dienste gleichzeitig zu sichern.
- Höhere Effizienz und höhere Belohnungen: Anstatt nur von einem Netzwerk zu profitieren, erhalten Sie Belohnungen sowohl von der ursprünglichen Chain als auch vom zusätzlichen Protokoll. Es ist kein zusätzliches Kapital erforderlich.
- Gemeinsame Sicherheit: Kleinere Projekte, die Schwierigkeiten haben, Staker anzuziehen, können sich Sicherheit von großen Netzwerken „ausleihen”. Dadurch sind sie schwerer anzugreifen und dezentraler.
- Zwei Formen:
- Natives Restaking – Validatoren melden sich direkt an (z. B. EigenLayer auf Ethereum).
- Liquid Restaking – erfolgt über Plattformen wie Puffer oder Ether.Fi, wo Sie handelbare Liquid Restaking Tokens (LRTs) erhalten.
- Zu beachtende Risiken: Restaking ist nicht risikofrei. Zusätzliche Slashing-Bedingungen, Smart-Contract-Bugs und die Möglichkeit einer Ansteckung über gemeinsame Sicherheitspools erhöhen die Komplexität.
Kurz gesagt, Restaking macht Kryptowährungen kapitaleffizienter und eröffnet neue Möglichkeiten für die Netzwerksicherheit. Es bringt jedoch auch Kompromisse mit sich, die jeder Investor abwägen sollte, bevor er sich darauf einlässt.
Was ist Restaking in Kryptowährungen?
Restaking-Projekte verwenden die gestakten Vermögenswerte, die zur Sicherung kleinerer Blockchain-Anwendungen verwendet werden, erneut. Anders ausgedrückt ermöglichen sie es den bestehenden Validator-Stakes, mehr als ein einziges Protokoll zu erhalten.
Dies kann die allgemeine Sicherheit der Bündelung des wirtschaftlichen Gewichts zahlreicher Projekte durch liquide Restaking-Protokolle verbessern.
Staking in Kryptowährungen beschreibt den Vorgang des Staking eines Vermögenswerts, der in einem zweiten Netzwerk oder Protokoll gestaked wurde. Einfach ausgedrückt besteht es darin, Ihre Kryptowährung (z. B. ETH) zu sichern, um den Betrieb einer Blockchain zu unterstützen, und dann gleichzeitig eine andere Blockchain oder Anwendung mit derselben Kryptowährung zu betreiben oder zu sichern, die Sie gestaked haben.
Auf diese Weise verdoppeln Sie im Wesentlichen Ihren Einsatz (auch als Re-Staking bezeichnet), den Sie auf der vorherigen Chain getätigt haben, und zwar nun auf einer neuen Plattform.
Dies wurde erstmals 2023 von EigenLayer auf Ethereum eingeführt. Im Jahr 2022 stellte Ethereum auf Proof of Stake um, wodurch Millionen von ETH in seiner Beacon Chain gestaked wurden. Das Konzept bei EigenLayer lautete: Können wir diese gestakten ETH besser nutzen, indem wir den Nutzern ermöglichen, ihre Vermögenswerte über mehrere Protokolle hinweg einzusetzen? Die Validatoren gewährleisten die Sicherheit von Ethereum, dürfen aber auch die Sicherheit anderer Dienste nebenbei gewährleisten.
EigenLayer schlug ein Protokoll vor, nach dem Ethereum-Validatoren ihre hinterlegten ETH als Sicherheit für andere Protokolle oder dApps (dezentrale Anwendungen) verpfänden und als Belohnung zusätzliche Gebühren erhalten können.
Tatsächlich stellt das Restaking von Ethereum für neue Projekte und dessen Export ein Staking von Ethereum für neue Projekte dar, damit diese von den Milliarden Dollar profitieren können, die bereits in Ethereum gestaked sind.
Ein Beispiel für die Stärke des Restaking findet sich in der folgenden Analogie des Gründers von EigenLayer. Wenn 100 verschiedene Blockchain-Anwendungen mit einem eigenen Einsatz von 1 Milliarde Dollar eingerichtet sind, kann sich ein Angreifer auf die kleinste Anwendung mit einem Gegenwert von 1 Milliarde konzentrieren und diese wahrscheinlich knacken.
Angenommen jedoch, dass diese 100 Apps über einen gemeinsamen Pool von 100 Milliarden Dollar verfügen, würde es 100 Milliarden Dollar kosten, eine davon zu kompromittieren.
Durch die gemeinsame Nutzung der Sicherheit über Restaking wird jedes Protokoll so sicher wie das gesamte System und nicht nur wie sein individueller Einsatz. „Stellen Sie sich vor, dass statt jedes Protokolls separat 1 Milliarde Dollar eingesetzt zu haben, 100 Milliarden Dollar gemeinsam über 100 Protokolle eingesetzt worden wären“, erklärte Sreeram Kannan, der Gründer von EigenLayer. „Um ein einzelnes Protokoll anzugreifen, benötigen Sie nun 100 Milliarden Dollar statt 1 Milliarde Dollar.“
Entscheidend ist, dass beim Restaking keine neuen Token gedruckt oder kostenloses Geld gezaubert wird – es wird lediglich das bereits Vorhandene umgenutzt. Ihre gestakten Kryptowährungen (wie ETH oder SOL) dienen als Sicherheit auf mehreren Plattformen. Das ähnelt der Wiederverwendung eines Vermögenswerts an mehreren Orten, weshalb es oft mit der Rehypothekarisierung (Wiederverwendung von Sicherheiten) im Finanzwesen verglichen wird.
Wenn es sorgfältig durchgeführt wird, kann Restaking den Nutzen von gestakten Kryptowährungen erhöhen und die Kapitaleffizienz verbessern (Sie erhalten mehr Output – Sicherheit und Belohnungen – aus dem gleichen Input an Token). Es bedeutet jedoch auch, dass Ihr einziger Vermögenswert nun mehrere Aufgaben erfüllt.
Wie funktioniert Crypto Restaking? Der Mechanismus hinter Restaking
Vergleich der heutigen Sicherheitsmodelle mit dem Restaking von EigenLayer (konzeptionelles Diagramm). Ohne Restaking (links) muss jede dezentrale App auf ihren eigenen kleinen Validator-Satz (oft als AVS bezeichnet) zurückgreifen, was zu hohen Kapitalanforderungen und einer geringeren Sicherheit führt.
Mit einem Restaking-Protokoll wie EigenLayer (rechts) kann der große Validator-Pool von Ethereum erweitert werden, um viele DApps über AVSs zu sichern, was die Sicherheit erheblich erhöht, gleichzeitig die Kapitaleffizienz verbessert und die Verwendung mehrerer Protokolle ermöglicht.
Auf hoher Ebene funktioniert Restaking, indem es eine Opt-in-Schicht auf einer Proof-of-Stake-Blockchain bereitstellt. Validatoren (oder sogar reguläre Token-Inhaber über bestimmte Dienste) können sich dafür entscheiden, ihre Token über ein Restaking-Protokoll „neu zu staken”.
Schauen wir uns einmal an, wie dies in der Praxis typischerweise funktioniert, wobei wir Blockchain und andere Protokolle wie Ethereums EigenLayer als primäres Beispiel verwenden:
- Opt-in als Validator: Sie sind ein Ethereum-Validator und staken in der Regel 32 ETH von Ethereum. Um auf EigenLayer einzulösen, würden Sie lediglich Ihre Auszahlungsdaten in der Ethereum-Beacon-Chain ändern, um den EigenLayer-Smart-Contract widerzuspiegeln. Dadurch wird Ihr gestaketer ETH einfach bei EigenLayer hinterlegt. Sie sind nach wie vor Validator bei Ethereum, aber Sie haben angegeben, dass Ihr Stake EigenLayer angeboten werden kann, sodass Sie gleichzeitig an mehreren Protokollen teilnehmen können.
- Auswahl zusätzlicher Protokolle (AVSs): Wenn Sie zusätzliche Protokolle (AVSs) ausgewählt haben, können Sie entscheiden, welche aktiv validierten Dienste (AVSs) Sie mit Ihrem Einsatz unterstützen möchten. AVSs sind Module oder Protokolle, die zusätzliche Sicherheit erfordern, z. B. ein Oracle-Netzwerk, eine Brücke, eine Datenverfügbarkeitskette usw. Sie können einige auswählen, von denen Sie überzeugt sind oder mit denen Sie zufrieden sind. EigenLayer bietet einen Markt für solche Module, auf dem Restaker je nach Höhe der Belohnungen, Risiko oder Präferenz auswählen können.
- Ausführen der erforderlichen Software: Für jedes AVS müssen Sie möglicherweise eine andere Software oder einen Oracle-Dienst auf Ihrem Knoten starten (z. B. kann ein Oracle-Dienst über einen eigenen Client verfügen, um Informationen zu melden). Restaking ist nicht einfach eine einmalige Angelegenheit, da Validatoren an den anderen Diensten arbeiten müssen, die sie abonniert haben. Dennoch können nicht alle die Zeit, das Fachwissen und die Ausrüstung aufbringen, um zusätzliche Module auszuführen. In diesen Situationen können die Validatoren solche Funktionen an Drittanbieter auslagern.
- Mehrere Belohnungen verdienen: Nach der Einrichtung bringt Ihr einzelnes gestaked Asset nun mehrere Belohnungsströme ein. Sie verdienen weiterhin Staking-Belohnungen aus der Basis-Blockchain (z. B. ETH-Belohnungen aus dem Ethereum-Protokoll) und erhalten zusätzliche Belohnungen oder Gebühren von jedem AVS, den Sie unterstützen. Diese zusätzlichen Belohnungen können verschiedene Formen annehmen: den eigenen Token des AVS, einen Anteil der Gebühren, die das AVS-Protokoll generiert, oder zusätzliche ETH, die von EigenLayer verteilt werden.
- Zusätzliche Slashing-Bedingungen: Mit höheren Belohnungen geht auch eine größere Verantwortung einher. Wenn Sie sich für das Restaking entscheiden, stimmen Sie auch den Slashing-Bedingungen jedes zusätzlichen Protokolls zu. Slashing bedeutet, dass ein Teil Ihres Einsatzes konfisziert werden kann, wenn Sie (oder der in Ihrem Namen handelnde Betreiber) die Regeln nicht befolgen oder böswillig auf einen unterstützten Dienst einwirken. Im Fall von EigenLayer könnte ein Restaking-Validator potenziell bis zu 100 % seiner gestakten ETH verlieren, wenn er gegen die Regeln eines der unterstützten Protokolle verstößt.
- Pooled Security Effect: Hinter den Kulissen aggregiert das Restaking-Protokoll alle diese Restaking-Token in einem gemeinsamen Sicherheitspool. Nehmen wir zum Beispiel an, dass 1.000 ETH-Validatoren jeweils in EigenLayer restaken – das ist effektiv ein großer Pool von bis zu 32.000 ETH, der jedes Projekt sichert, das EigenLayer verwendet. Eine neue DeFi-App könnte gestartet werden und EigenLayer verwenden, anstatt einen eigenen Token für die Sicherheit auszugeben oder eigene Validatoren zu rekrutieren, sodass Benutzer dieselben Token über mehrere Protokolle hinweg staken können. Die App profitiert von Ethereums vertrauenswürdigem Validator-Set und der enormen wirtschaftlichen Sicherheit, die sie als kleines Start-up-Projekt allein niemals hätte erreichen können.
- Restaking über Liquid Tokens: Sie müssen nicht unbedingt ein großer Validator mit 32 ETH sein, um teilzunehmen. Viele Restaking-Protokolle akzeptieren auch Liquid Staking Tokens (LSTs) oder andere gestakte Asset-Derivate. Wenn Sie beispielsweise stETH (Lidos Liquid Token für gestakte Ether) besitzen, können Sie diesen zum Restaking verwenden. EigenLayer und andere erlauben Einzahlungen bestimmter LSTs oder LP-Token aus DeFi als Sicherheit für das Restaking.
- Beispiel außerhalb von Ethereum – Solana: Während EigenLayer das Aushängeschild für Restaking auf Ethereum ist, verbreitet sich das Konzept zunehmend. Solana plant beispielsweise eine Restaking-ähnliche Funktion, mit der Benutzer SOL (den nativen Token), den sie bereits auf Solana gestaked haben, erneut staken können, um andere Solana-basierte Apps zu sichern und zusätzliche Zinsen zu verdienen. Andere Netzwerke wie NEAR haben ebenfalls ähnliche Ideen untersucht. Die Details unterscheiden sich je nach Blockchain, aber die Kernidee ist dieselbe: die gestakten Vermögenswerte des Hauptnetzwerks zu nutzen, um die Sicherheit des gesamten Ökosystems zu erhöhen.
Die wichtigsten Vorteile von Restaking
1. Doppelte oder dreifache Belohnungen
Der größte direkte Vorteil ist die höhere Rendite. Traditionelles Staking bietet einem Investor möglicherweise eine jährliche Rendite von 5 Prozent. Restaking bietet die Möglichkeit, zusätzliche Renditen auf die gestakten Vermögenswerte zu erzielen, ohne diese abheben oder zusätzliche Mittel einzahlen zu müssen. Im Grunde genommen sind die Token dieselben, die verschiedene Einnahmequellen generieren, und daher sind sie produktiver.
2. Kapitaleffizienz
Beim herkömmlichen Staking werden Vermögenswerte sicher verwahrt und können nicht anderweitig verwendet werden. Restaking eröffnet einen zweiten Anwendungsfall. Im Falle von Liquid Restaking Tokens (LRTs) kann ein Investor beispielsweise die Vermögenswerte, die er in DeFi gestaked hat, handeln oder nutzen und gleichzeitig zu verschiedenen Protokollen beitragen. Dies erhöht die Liquidität und den Nutzen und ermöglicht es dem Ökosystem, mit weniger gesperrten Vermögenswerten mehr zu erreichen.
3. Gemeinsame Sicherheit
Kleine oder neue Projekte haben oft Schwierigkeiten, genügend Staker zu gewinnen, um ihre Netzwerke zu sichern. Hier ermöglicht Restaking eine breitere Beteiligung. Durch Restaking können sie sich Sicherheit von großen Blockchains wie Ethereum „ausleihen”. Dieser gepoolte Schutz erhöht die Kosten für Angriffe und verringert Schwachstellen. In der Praxis ist es so, als würde eine Gemeinschaft eine einzige, leistungsstarke Sicherheitskraft teilen, anstatt dass jedes Projekt seine eigene anheuert.
4. Impuls für Innovation
Die Einführung eines Blockchain-Dienstes erfordert normalerweise, dass Menschen davon überzeugt werden, einen neuen Token zu staken. Restaking senkt diese Hürde. Entwickler können Sicherheit von einem bestehenden Restaking-Netzwerk mieten und so Experimente und Bereitstellungen beschleunigen. Dieses Modell ermöglicht bereits neue Dienste wie Bridges und Oracle-Netzwerke, die sich auf restaked ETH verlassen können, anstatt eine eigene Validator-Basis zu schaffen.
5. Mehr Auswahl für Staker
Restaking ermöglicht es Anlegern, ihre Staking-Strategie zu diversifizieren. Sie können Sicherheit auf der Grundlage von Risikopräferenzen oder persönlichen Interessen auf verschiedene Projekte verteilen, indem sie DeFi-Dienste in der Frühphase für höhere Renditen unterstützen oder sich für Stabilität an etablierte Protokolle halten. Diese Personalisierung sorgt auch für eine Angleichung der Anreize, da Staker direkt die Ökosysteme unterstützen können, an die sie glauben.
6. Stärkung der Dezentralisierung
Durch die Verteilung der Sicherheit auf kleinere Projekte ermöglicht Restaking die Schaffung eines stärker dezentralisierten Multi-Chain-Ökosystems. Unabhängige Blockchains erhalten Zugang zu starkem Schutz, ohne sich mit größeren Plattformen zusammenschließen oder auf zentralisierte Lösungen angewiesen sein zu müssen.
7. Förderung von DeFi und Liquidität
LRTs verbessern nicht nur die Effizienz, sondern fügen DeFi auch neue Vermögenswerte hinzu und erweitern damit die Möglichkeiten von Liquid-Restaking-Protokollen. Diese Token können gehandelt, verliehen oder als Sicherheit verwendet werden, wodurch Liquidität bereitgestellt wird, die zuvor in Staking-Verträgen gebunden war. Diese Kombinierbarkeit stärkt das gesamte DeFi-Ökosystem.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Restaking ein Win-Win-Modell schafft: Staker maximieren die Rendite ihrer Vermögenswerte, während neue Projekte Zugang zu Sicherheit auf Unternehmensniveau erhalten. Diese Kombination erklärt, warum Restaking als vielversprechender Wachstumsmotor im Blockchain-Bereich angesehen wird.
Hauptrisiken des Restaking
Obwohl Restaking eine lohnende Idee ist, birgt es auch erhebliche Herausforderungen. Hier sind einige Risiken, die man vor einer Beteiligung verstehen sollte.
1. Komplexität und Benutzerfehler
Im Gegensatz zum One-Click-Staking gibt es beim Restaking mehrere Plattformen und Protokolle. Falsche Einstellungen, wie Fehler bei den Auszahlungsdaten oder die Nutzung unzuverlässiger Dienste von Drittanbietern, können zu Geldverlusten führen. Die Komplexität erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.
2. Slashing-Risiken
Mit Restaking sind mehr Slashing-Bedingungen verbunden. Ein Validator kann sogar dann Geld verlieren, wenn eines der Restaking-Protokolle ausfällt oder angegriffen wird, selbst wenn der Validator auf Ethereum korrekt funktioniert. Dies konzentriert die Risiken über alle Systeme hinweg und führt zu einer Situation, in der ehrliche Validatoren Geld verlieren. Im schlimmsten Fall können Restaker aufgrund erhöhter Slashing-Risiken ihren gesamten Einsatz verlieren.
3. Schwachstellen in Smart Contracts
Smart Contracts sind für Restaking-Plattformen von entscheidender Bedeutung, können jedoch fehlerhaft sein. Mit mehr Verträgen steigen auch die Chancen auf Abenteuer oder eingefrorenes Geld. Diese Systeme sind nicht praxiserprobt, da das Restaking noch relativ neu ist.
4. Kontrahentenrisiko
Die Restaking-Vorgänge werden von vielen Nutzern an die Betreiber oder Börsen delegiert. Dies birgt ein Vertrauensrisiko. Delegierte würden im Falle einer Misswirtschaft oder eines Verstoßes gegen die Protokolle durch einen Betreiber mit Slashing bestraft werden. Es gibt keine Zahlungsgarantie, daher ist es wichtig, vertrauenswürdige Betreiber auszuwählen.
5. Ansteckungsgefahr und systemisches Risiko
Aufgrund der Verbindung zwischen mehreren Diensten können sich Probleme in einer Region aufgrund von Restaking schnell ausbreiten. Ein großer Exploit-/Slashing-Vorfall kann auf das gesamte Ökosystem übergreifen und das Vertrauen in das gesamte System schwächen. Dies lässt sich mit Finanzkrisen vergleichen, bei denen miteinander verbundene Risiken zu umfangreichen Ausfällen führen.
6. Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung
Restaking führt möglicherweise nicht zu einer Dezentralisierung der Macht, sondern zu einer Konzentration. Wenn eines der Protokolle, wie beispielsweise EigenLayer, eine dominante Stellung einnimmt, können große Mengen an ETH darüber abgewickelt werden, was zu einem Single Point of Failure führt. Ebenso haben wenige große Betreiber, die den Großteil der restakten Vermögenswerte besitzen, eine unverhältnismäßig große Macht, was die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks verringert.
7. Wirtschaftliche Risiken und Anreizrisiken
Restaking verändert die Dynamik der Belohnungen. Projekte könnten miteinander konkurrieren, indem sie höhere Renditen anbieten, was jedoch nicht nachhaltig sein und zu einer Token-Inflation führen kann. Eine übermäßige Überlagerung von Renditechancen birgt auch das Risiko einer übermäßigen Hebelwirkung, bei der Nutzer Stakes setzen, LSTs erhalten, diese in LRTs umwandeln und diese in anderen Protokollen verwenden. Dieses „Yield Stacking” kann sich dramatisch auflösen, wenn ein Teil der Kette versagt, was an Finanzblasen erinnert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Restaking?
Restaking bedeutet, bereits gestakte Kryptowährungen zu verwenden, um eine andere Plattform zu sichern, ohne sie zu entstaken. Beispielsweise kann ETH, das auf Ethereum gestaked wurde, auch über Protokolle wie EigenLayer verwendet werden, um andere Netzwerke zu unterstützen und so zusätzliche Belohnungen zu verdienen, während mehrere Systeme gesichert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Staking und Restaking?
Das Sperren von Token auf einer Blockchain, um Transaktionen zu validieren und Belohnungen zu verdienen. Die erneute Verwendung dieser gestakten Token, um andere Protokolle zu sichern und so mehrere Belohnungsströme zu schaffen. Kurz gesagt, Staking entspricht einem Netzwerk; Restaking bedeutet ein Netzwerk plus andere, jedoch mit zusätzlichen Risiken, insbesondere in Bezug auf erhöhte Slashing-Risiken.
Was ist das Restaking von Kryptowährungen?
Es handelt sich um die Praxis, gestakte Token in neuen Protokollen (z. B. EigenLayer) einzusetzen, um den Nutzen und die Belohnungen zu erhöhen. Restaking steigert das Verdienstpotenzial, ist jedoch im Vergleich zum einfachen Staking mit zusätzlichen Risiken und Komplexität verbunden.
Was ist BTC-Restaking?
Da Bitcoin kein natives Staking hat, verwendet BTC-Restaking Sidechains, Time-Locks oder Protokolle wie Babylon und BounceBit, um den Inhabern die Möglichkeit zu geben, Belohnungen zu verdienen. BTC bleibt in seiner Chain gesichert, während es an andere Systeme verpfändet wird, was die Vielseitigkeit von Liquid-Restaking-Protokollen zeigt. Dies macht Bitcoin in DeFi produktiv, aber die Lösungen sind neu und bergen höhere Risiken.






